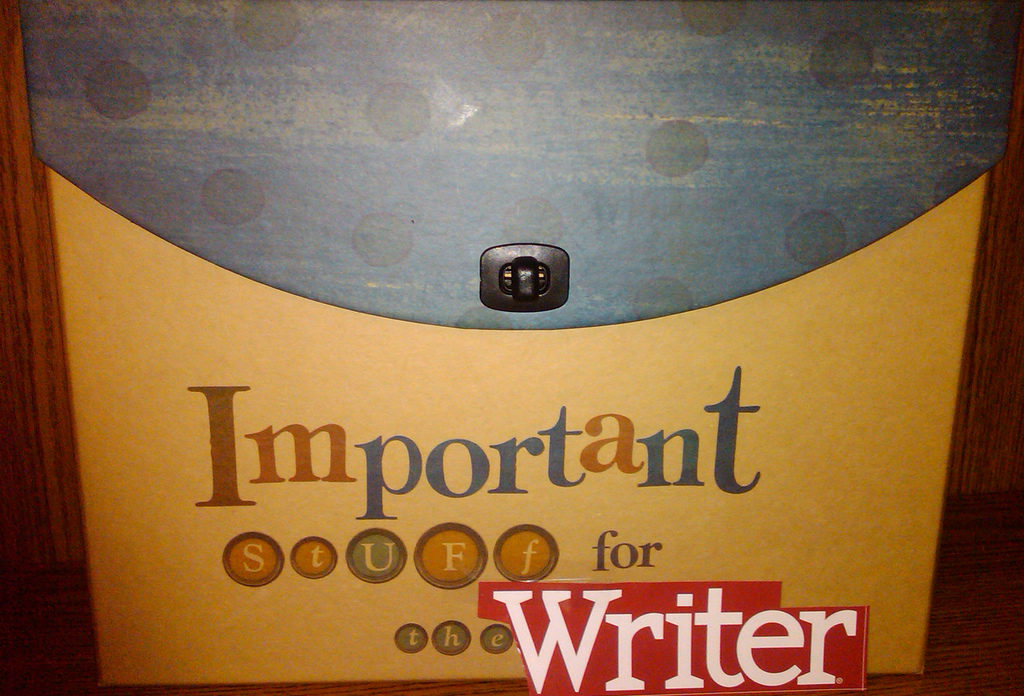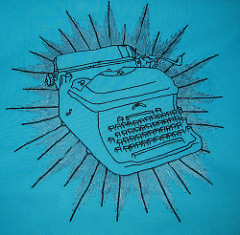Der erste Gastbeitrag, der mich erreichte (wenn auch nicht der Erste hier veröffentlichte), hat mich besonders gefreut. Denn er kam von keiner geringeren als Larissa vom No Robots Magazine. Eine meiner Lieblings- und Herzbloggerinnen, die hier sehr persönlich über eine Perspektive auf den After Baby Body schreibt, die es so auf dem Blog noch nicht gab. Danke, Larissa!
Neulich in der Babygruppe: Ein paar junge Mütter mit noch recht kleinen Babys unterhalten sich.
Mutter 1 an Mutter 2: „Du hast deine Figur aber auch schon wieder zurück!“
Mutter 2: „Ja, das war auch kein Problem. War eigentlich gleich wieder so, als ich aus dem Krankenhaus kam.“
Mutter 3: „Ey, davon will ich gar nichts hören!“
Er wird ja viel besungen, der After Baby Body.
Die Magazine bejubeln Stars, wie toll sie kurz nach der Geburt wieder aussehen. Die Normalo-Frau weint entweder, weil sie das mit dem After Baby Body nicht so toll hinbekommt wie eine Gisele Bündchen oder weil sie den Druck, der auf junge Mütter gemacht wird, für absolut unverschämt hält.
 Larissa sagt selbst, dass ihr „ganzes Leben doch irgendwie online ist“ und bloggt seit 2014 auf No Robots Magazine. In ihrem Blogzine findet ihr wunderbare Texte über das Leben, Kunst und Kommerz – immer mit klugem Blick für gesellschaftliche Themen. Unbedingt reinlesen! Larissa ist übrigens freie Redakteurin. Man kann sich ihr Talent also auch gern gegen Geld sichern.
Larissa sagt selbst, dass ihr „ganzes Leben doch irgendwie online ist“ und bloggt seit 2014 auf No Robots Magazine. In ihrem Blogzine findet ihr wunderbare Texte über das Leben, Kunst und Kommerz – immer mit klugem Blick für gesellschaftliche Themen. Unbedingt reinlesen! Larissa ist übrigens freie Redakteurin. Man kann sich ihr Talent also auch gern gegen Geld sichern.
Weil sie den Begriff After Baby Body nicht mehr hören kann. After Baby Body? Was soll das denn überhaupt? Muss man darüber überhaupt reden? Nun, ob man muss, das weiß ich nicht. Aber offensichtlich wird darüber geredet. Warum also nicht mal die fragen, die sonst nie reden dürfen. Die, die lobend in Magazinen gezeigt werden. Die, die sich ein bisschen schämen, dass sie eine Woche nach der Geburt wieder in ihre engen alten Jeans passen. Ich bin so eine Frau.
Und dahinter steckt kein Wunderwerk, kein Diät-Wahn, kein hartes Trainingsprogramm. Ja, früher, da dachte ich mal: „Wow, wenn man in der Schwangerschaft seine Figur verliert, dann mache ich währenddessen auf jeden Fall ganz viel Sport! Ich will danach wieder so aussehen wie vorher!“ Ja, und? Pustekuchen! Die ersten drei Monate lag ich auf dem Sofa und habe im Halbschlaf wimmernd Netflix geguckt. Die letzten Wochen lag ich wie ein dicker Käfer auf dem Rücken und habe mit Armen und Beinen gewedelt, um wieder auf die Füße zu kommen.
Okay, ja, dazwischen habe ich sehr diszipliniert jeden Tag Pilates gemacht. Aber nicht für meine Figur, sondern weil es mir gut tat und es die Rückenschmerzen im Rahmen hielt. Also, was ist nun mein geheimer „Schlank nach der Geburt“-Super-Tipp? Hab ich nicht. Ich bin einfach so. War ich schon immer. Mir wurde es leicht gemacht dank genetischem Vorteil, moderatem Heißhunger und kaum Gelüsten (außer einer Vorliebe für Pflaumen).
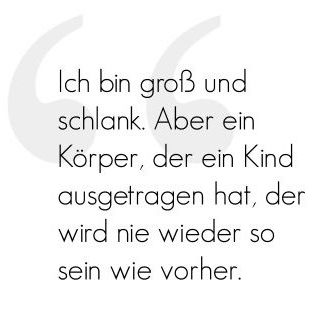 Jetzt sitzen sie da, all die Mütter, denen es nicht so geht und sagen: „Ja, ist ja toll für dich. Halt doch die Klappe und sei froh!“ Ich halte aber nicht die Klappe. Denn, wenn wir schon vom After Baby Body reden, dann seien wir doch ehrlich: Ein Körper, der ein Kind ausgetragen hat, der wird nie wieder so sein wie vorher. Ich bin groß und schlank, genau wie meine Mutter in meinem Alter auch. Es gibt ein Bild von ihr im neunten Monat, wie sie den Bauch extra weit raus streckt, damit man überhaupt etwas sieht. Ich war überzeugt, dass es bei mir auch so sein wird. Lange habe ich mich gefreut, dass man mir die Schwangerschaft kaum ansah, während ich trotzdem meinen kleinen Bauch raus gestreckt habe, stolz auf das wachsende Bäuchlein. Noch im achten Monat bin ich in Salzburg die Berge hoch gestiefelt. Jubelte jeden Morgen beim Einölen, dass ich ohne Streifen durchkommen würde. Und dann: Boom! Gefühlt innerhalb von einer Nacht explodierte mein Bauch förmlich. Mein Kind ist nämlich auch groß. Und war bei der Geburt kein Leichtgewicht – dass es sich noch fast eine Woche über Entbindungstermin Zeit ließ, machte die Sache nicht besser. Und so schob ich schließlich meinen Riesenbauch in den Kreißsaal und presste in einer nicht-komplikationsfreien Geburt trotz PDA unter Höllenschmerzen mein Kind heraus.
Jetzt sitzen sie da, all die Mütter, denen es nicht so geht und sagen: „Ja, ist ja toll für dich. Halt doch die Klappe und sei froh!“ Ich halte aber nicht die Klappe. Denn, wenn wir schon vom After Baby Body reden, dann seien wir doch ehrlich: Ein Körper, der ein Kind ausgetragen hat, der wird nie wieder so sein wie vorher. Ich bin groß und schlank, genau wie meine Mutter in meinem Alter auch. Es gibt ein Bild von ihr im neunten Monat, wie sie den Bauch extra weit raus streckt, damit man überhaupt etwas sieht. Ich war überzeugt, dass es bei mir auch so sein wird. Lange habe ich mich gefreut, dass man mir die Schwangerschaft kaum ansah, während ich trotzdem meinen kleinen Bauch raus gestreckt habe, stolz auf das wachsende Bäuchlein. Noch im achten Monat bin ich in Salzburg die Berge hoch gestiefelt. Jubelte jeden Morgen beim Einölen, dass ich ohne Streifen durchkommen würde. Und dann: Boom! Gefühlt innerhalb von einer Nacht explodierte mein Bauch förmlich. Mein Kind ist nämlich auch groß. Und war bei der Geburt kein Leichtgewicht – dass es sich noch fast eine Woche über Entbindungstermin Zeit ließ, machte die Sache nicht besser. Und so schob ich schließlich meinen Riesenbauch in den Kreißsaal und presste in einer nicht-komplikationsfreien Geburt trotz PDA unter Höllenschmerzen mein Kind heraus.
Mein Körper war danach nicht der selbe.
Ja, zehn Tage nach der Geburt probierte ich mal meine frühere Lieblingsjeans an (Skinny-Schnitt, W29, L34) und sie passte.
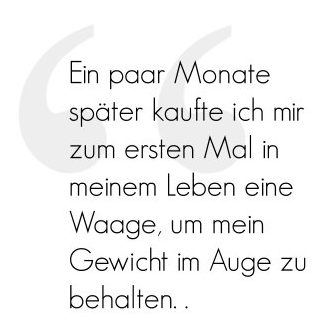 Aber makelloser Body? Von wegen! Der Bauch, der nie wirklich trainiert war, war schlaff und zerrissen. Zwar wurden die dunklen Streifen im Laufe der Zeit blasser und ein bisschen Bauch bildete sich zurück, aber auch jetzt nach fast einem Jahr sieht man ihm trotzdem noch an, dass er ein Kind getragen hat. Nein, ich habe keine Pfunde behalten. Kurz nach der Geburt betrachtete ich mich im Spiegel und erschrak vor mir selbst. Ich kam mir vor wie ein wandelndes Skelett. Ein paar Monate später kaufte ich mir zum ersten Mal in meinem Leben eine Waage, um mein Gewicht im Auge zu behalten. Ich habe vier Monate voll gestillt. Mein Kind hatte großen Hunger, ich wenig Zeit zum essen. Tipp á la „So verlieren Sie Ihre Pfunde nach der Schwangerschaft“?: Stillen und keinen haben, der für einen kocht. Ich hielt mit einem Arm das Baby, um mir mit dem anderen alles in den Mund zu stopfen, was man schnell auf die Hand essen kann (vor allem Bio-Dinkel-Waffeln von DM, in großen Mengen). Und fühlte mich dabei wie ein ausgesaugtes Haut-Gespenst.
Aber makelloser Body? Von wegen! Der Bauch, der nie wirklich trainiert war, war schlaff und zerrissen. Zwar wurden die dunklen Streifen im Laufe der Zeit blasser und ein bisschen Bauch bildete sich zurück, aber auch jetzt nach fast einem Jahr sieht man ihm trotzdem noch an, dass er ein Kind getragen hat. Nein, ich habe keine Pfunde behalten. Kurz nach der Geburt betrachtete ich mich im Spiegel und erschrak vor mir selbst. Ich kam mir vor wie ein wandelndes Skelett. Ein paar Monate später kaufte ich mir zum ersten Mal in meinem Leben eine Waage, um mein Gewicht im Auge zu behalten. Ich habe vier Monate voll gestillt. Mein Kind hatte großen Hunger, ich wenig Zeit zum essen. Tipp á la „So verlieren Sie Ihre Pfunde nach der Schwangerschaft“?: Stillen und keinen haben, der für einen kocht. Ich hielt mit einem Arm das Baby, um mir mit dem anderen alles in den Mund zu stopfen, was man schnell auf die Hand essen kann (vor allem Bio-Dinkel-Waffeln von DM, in großen Mengen). Und fühlte mich dabei wie ein ausgesaugtes Haut-Gespenst.
Makelloser Body? Pah, von wegen! Mein erster „Ausflug“ nach der Geburt ging nach zwei Wochen zu Rossmann – zwei Häuser weiter. Auf dem Rückweg hatte ich solche Schmerzen, dass ich den Weg kaum geschafft hätte. Es dauerte Monate, bis ich wieder richtig laufen konnte. Manchmal merke ich die Geburtsverletzungen heute noch. Ja, auch das gehört zum After Baby Body. Wer sagt denn, dass es einer Gisele Bündchen anders geht?
Und mal ganz ehrlich: Guckt man sich After Baby Body-Galerien der Stars an, dann sieht man meistens auch eher weite Kleidung, die den postpartalen Bauch kaschiert. Man kann nämlich auch mit Schwabbel und Schwangerschaftssstreifen heiß aussehen.
Foto: flickr – andrea – CC by 2.0