Vor Kurzem führte ich zufällig ein Gespräch über Aufklärungsunterricht in Schulen. Ich hatte auf Pornokonsum und den Einfluss auf die Sexualität der Jugendlichen getippt, als ich fragte, was an dem Thema das Wichtigste sei. Oder die Tatsache, dass es im Sexualkundeunterricht meist nur Mann und Frau gibt und nichts anderes. Und was macht das mit denen, die sowieso schon zerrissen sind, weil sie anders lieben?
Die Antwort war aber eine andere: „Wir bringen ihnen alles über Verhütung bei, aber nichts übers Kinder kriegen. Wenn man die Mädchen fragt, was rein biologisch die beste Zeit wäre, um Kinder zu bekommen, sagen die 27 bis 30. Auch in der Abiturstufe.“*
Mein Verstand schaltete in diesem Moment zunächst auf Gegenwehr.
Kann ja nicht sein, ist ja jeder Frau selbst überlassen, ob sie Kinder kriegt. Ein Unterricht, der indirekt dazu drängt, weil irgendwann der Zug einfach abgefahren ist, der beibringt, wie man fruchtbare Tage erkennt – mit Zervixschleim und LH-Anstieg, damit die Chancen steigen, das schien mir doch ein bisschen Mittelalter.
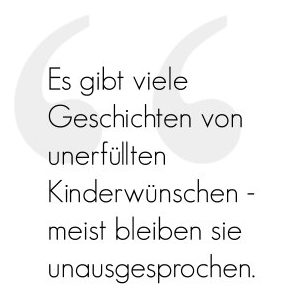 Oder war an der Idee, Planbarkeit in beide Richtungen zu zeigen vielleicht doch etwas dran? Jede, die aufmerksam zuhört, die vielleicht selbst schon einmal gegoogelt hat, kennt Geschichten vom unerfüllten Kinderwunsch. Von psychisch und physisch belastenden Behandlungen, von Großpackungen Schwangerschaftstests, von den ungezählten Hibblerinnen (Selbstbezeichung der Frauen in Foren), die jeden Monat wieder hoffen, dass es endlich geklappt hat. In den Geschichten schwingt nicht selten Wehmut mit. Vielleicht hätte man es bereits ein paar Jahre früher probieren sollen. Eine Kollegin zeigte sich entsetzt über ihre Frauenärztin. Die hatte sie, das erste Kind war inzwischen 2 Jahre alt, im Gespräch darauf hingewiesen, dass mit 35 nicht mehr alle Zeit der Welt vor ihr liegen würde. Sie hatte ihr vorher bereits gesagt, dass sie irgendwann ein zweites Kind plante. Ab 35 gilt man als Risikoschwangerne, weil die Risiken für Fehlgeburt, Schwangerschaftsdiabetes und Fehlbildungen steigen. Die rein statistische Chance, auf natürlichem Weg schwanger zu werden, ist da schon ein paar Jahre am Sinken. Gesellschaftlich ist man mit 35 jung. Hat, auch bei relativ geradem Weg, sich selbst und die berufliche Orientierung vielleicht erst vor ein paar Jahren gefunden.
Oder war an der Idee, Planbarkeit in beide Richtungen zu zeigen vielleicht doch etwas dran? Jede, die aufmerksam zuhört, die vielleicht selbst schon einmal gegoogelt hat, kennt Geschichten vom unerfüllten Kinderwunsch. Von psychisch und physisch belastenden Behandlungen, von Großpackungen Schwangerschaftstests, von den ungezählten Hibblerinnen (Selbstbezeichung der Frauen in Foren), die jeden Monat wieder hoffen, dass es endlich geklappt hat. In den Geschichten schwingt nicht selten Wehmut mit. Vielleicht hätte man es bereits ein paar Jahre früher probieren sollen. Eine Kollegin zeigte sich entsetzt über ihre Frauenärztin. Die hatte sie, das erste Kind war inzwischen 2 Jahre alt, im Gespräch darauf hingewiesen, dass mit 35 nicht mehr alle Zeit der Welt vor ihr liegen würde. Sie hatte ihr vorher bereits gesagt, dass sie irgendwann ein zweites Kind plante. Ab 35 gilt man als Risikoschwangerne, weil die Risiken für Fehlgeburt, Schwangerschaftsdiabetes und Fehlbildungen steigen. Die rein statistische Chance, auf natürlichem Weg schwanger zu werden, ist da schon ein paar Jahre am Sinken. Gesellschaftlich ist man mit 35 jung. Hat, auch bei relativ geradem Weg, sich selbst und die berufliche Orientierung vielleicht erst vor ein paar Jahren gefunden.
Theoretisch mögen wir die biologischen Fakten kennen.
Die unterschwellige Wahrnehmung ist trotzdem oft eine andere. Da kriegen doch so viele scheinbar problemlos Kinder mit Ende 30 (Weil leider auch im engsten Kreis selten über Probleme geredet wird.). Prominente sowieso und war da nicht auch die Sache mit den eingefrorenen Eizellen in allen Medien? Was die breite Berichterstattung oft nur am Rande erwähnte: es handelt sich um eine Methode, bei der noch nicht klar ist, wie groß die Erfolgschancen am Ende überhaupt sind. Und Reproduktionsmediziner erzählen, dass Frauen Anfang 30 zu ihnen kommen, um Eizellen einzufrieren. Gekommen wären sie aber besser schon mit 25. Aber da sind die Gedanken an Kinder eben noch relativ weit weg. Oder der Partner noch nicht da.
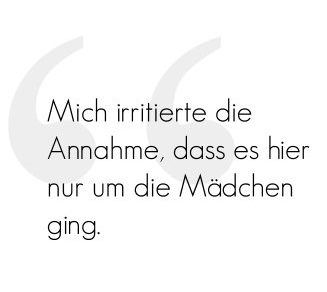 Das war der Punkt, an dem ich wusste, wieso mich das Gespräch eigentlich irritiert hatte. Es war nicht die Idee, dass man Mädchen mehr über Planbarkeit beibringen sollte – nicht nur in Richtung Verhütung. Es war die Annahme, dass es nur um Mädchen ging. Kinder allein Frauensache waren. Ultimativ verantwortlich für das Vermeiden ungewollter Schwangerschaften sind sie sowieso. Die meisten von ihnen belasten ihren Körper deswegen mit Hormonen, obwohl hier langsam ein Umdenken einsetzt. Und nun auch noch die Verantwortung dafür, dass das Herbeiführen einer Schwangerschaft klappt. Passt bloß auf, dass ihr den Punkt nicht verpasst. Dabei ist die karriereorientierte Frau, die Kinder immer weiter aufschiebt, von einem Aufstieg zum anderen, ein Zerrbild. Fragt man Frauen nach den Gründen für Kinderlosigkeit bei eigentlichem Kinderwunsch, nennen sie überproportional häufig das Fehlen eines Partners. Der für erfolgreiche Frauen aufgrund veralteter Rollenbilder unter Umständen noch schwerer zu finden ist. Aber auch genug Nicht-Vorstandsvorsitzenden geht es so.
Das war der Punkt, an dem ich wusste, wieso mich das Gespräch eigentlich irritiert hatte. Es war nicht die Idee, dass man Mädchen mehr über Planbarkeit beibringen sollte – nicht nur in Richtung Verhütung. Es war die Annahme, dass es nur um Mädchen ging. Kinder allein Frauensache waren. Ultimativ verantwortlich für das Vermeiden ungewollter Schwangerschaften sind sie sowieso. Die meisten von ihnen belasten ihren Körper deswegen mit Hormonen, obwohl hier langsam ein Umdenken einsetzt. Und nun auch noch die Verantwortung dafür, dass das Herbeiführen einer Schwangerschaft klappt. Passt bloß auf, dass ihr den Punkt nicht verpasst. Dabei ist die karriereorientierte Frau, die Kinder immer weiter aufschiebt, von einem Aufstieg zum anderen, ein Zerrbild. Fragt man Frauen nach den Gründen für Kinderlosigkeit bei eigentlichem Kinderwunsch, nennen sie überproportional häufig das Fehlen eines Partners. Der für erfolgreiche Frauen aufgrund veralteter Rollenbilder unter Umständen noch schwerer zu finden ist. Aber auch genug Nicht-Vorstandsvorsitzenden geht es so.
Die Gründe, warum Männer sich nicht binden wollen, mögen vielfältig sein.
Aber auch bei ihnen gibt es undurchdachte Mythen, was das Vaterwerden betrifft. So wie manche Frauen denken, es ist immer noch ein bisschen Zeit, schaukeln Männer gern in der Selbstvergewisserungshängematte, dass das starke Geschlecht ja immer Kinder zeugen könnte. Was nur halb stimmt. Denn auch hier nimmt nicht nur die Spermienqualität mit zunehmendem Alter ab.
Reden müsste man also mit Mädchen und Jungen. Über das gleiche Thema. Weil es beide angeht. Dann ist die Frage nicht, wie spät ist zu spät, um über die biologische Uhr zu reden, sondern mit wem sollten wir sprechen.
***
*In einer Studie im Auftrag des Bundesfamilienministeriums von 2005, gaben die befragten Frauen (18 bis 44 Jahre) 24 bis 31 Jahre als das optimale Alter an, um Kinder zu bekommen. Persönlich fühlen sich 65% der 23-26jährigen Kinderlosen, die für sich Kinder nicht ausschließen, aber zu jung, um sie zu bekommen (26% der 27-30jährigen und 20% der 31-35jährigen).
Foto: flickr – white_fundude – CC by 2.0






