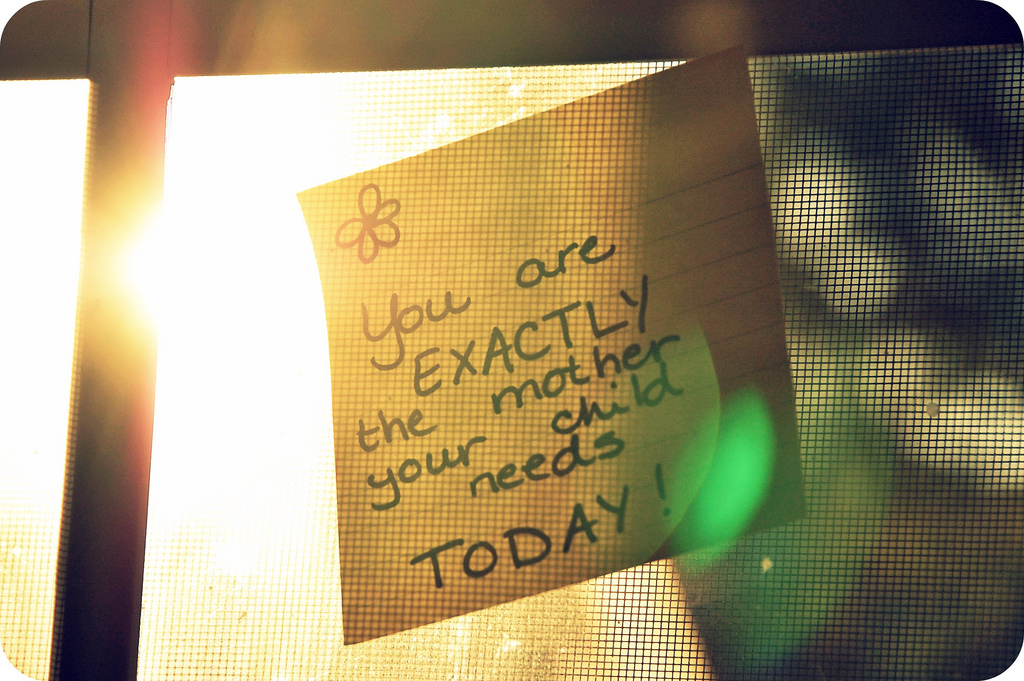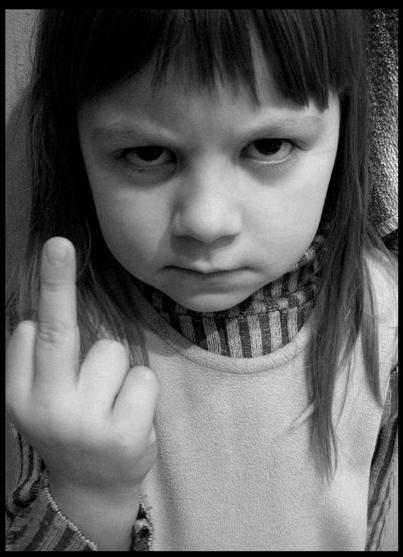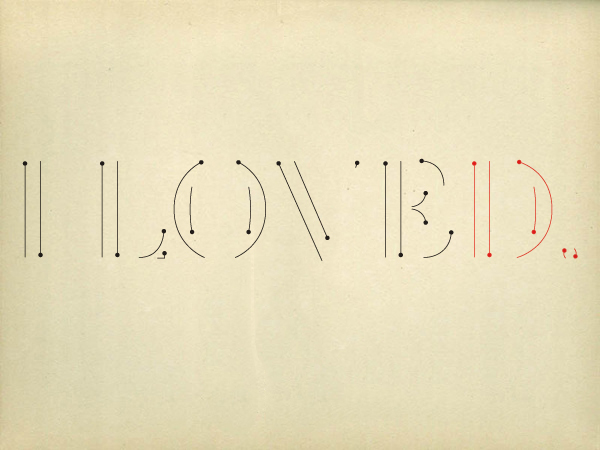Heute ist der Tag der großen Essays. Aber es will mir nicht gelingen. Ich überlege, woran es liegen könnte. Wer sind die Frauen und was wollen sie? Eine Frage, die 1999 n.Chr. schon die große Philosophin Christina Aguilera nur vage stellte: What a girl wants, what a girl needs nanana, lalala, something, hm…Was „was“ ist, bleibt im Dunkeln. Auch wenn wir uns inzwischen vom Sony Discman zum iPhone vorgearbeitet haben, klingt die Frage auch im neuen Jahrtausend noch in den Ohren.
Aber das ist es nicht. Frauen mögen keine homogene Masse mit gemeinsamen Wunschzettel sein. Aber es fällt genug ein, was man auf den Forderungskatalog setzen könnte: Sexualstrafrecht, Equal Pay, Care Arbeit, humane Arbeitskultur, steuerliche Förderung von Kindern und nicht der Ehe. Was ich eigentlich schreiben will, hat wahrscheinlich einfach wenig mit Feminismus zu tun. Oder ganz viel. Ich will schreiben: Wir sollten alle rücksichtsvoller und netter zueinander sein. Nun kommt man sich kindisch vor, wenn man solche simplen Tatsachen aufschreibt. Ich selbst scheitere täglich an dieser Mission. Ich will manchmal nicht reden, obwohl ich weiß, dass jemand meine Worte braucht. Ich sehe einen Geburtstag auf Facebook aber gratuliere einfach nicht. Ich gebe nicht immer etwas für den, der auf der Straße sitzt und die Hand aufhält, obwohl ich danach einen überteuerten Kaffee kaufe. Ich sage gemeine Dinge über andere ohne wirklichen Grund. Ich habe Menschen schlecht behandelt und ihre Verletzlichkeit nicht respektiert.
Ich sollte also keine Ratschläge geben. Und doch denke ich, dass ein paar Dinge unsere Tage einfacher gestalten würden. Wir könnten zum Beispiel aufhören, andere im Straßenverkehr zu beschimpfen. Wir könnten keine Witze mehr machen, bei denen die Pointe auf Kosten von Schwächeren geht. Wir könnten versuchen, falsche Wörter zu verlernen und zuzuhören, welche anderen wir benutzen können. Wir könnten Menschen und die Pronomen, mit denen sie gern bezeichnet werden, respektieren. Es tut nicht weh zu hinterfragen, ob Verhaltensweisen, die man mit 14 hatte, noch die richtigen sind.
Wenn jemand von meinen Worten oder Taten verletzt wurde, will ich nicht sofort in die Defensive gehen. Wenn ich etwas sehe, dass mich beunruhigt und ich mich sicher genug fühle, will ich nachfragen, ob alles ok ist. Wenn ich mich nicht sicher genug fühle, will ich Hilfe rufen. Ich will rückwärtsgewandte Einstellungen konsequent hinterfragen, ob sie von Freunden kommen oder von Menschen, die in einer Machtposition mir gegenüber sind. Ich will lächeln, wenn ich lächeln will. Und nur dann. Ich will Menschen vergeben, die mich verletzt haben. Ärger und Verbitterung sind schlechte Ratgeber. Ich will niemanden verletzen, um das Machtgefälle wieder auszugleichen. Ich will anerkennen, dass die Gedanken von Menschen unterschiedlich sind. Manche kann ich unglaublich leicht nachvollziehen und andere bleiben mir sehr fremd. Ich will mir dessen bewusst sein, wenn ich bewerte.
Symbolträchtige Tage fragen gern nach historischen Rückschauen. Ich denke an das Fahrradgesicht. Die Erfindung des Fahrrads bedeutete mehr weibliche Freiheit, eine neue Dimension von Mobilität. Die Rocksäume rutschten höher für mehr Beweglichkeit und definierten Mode und Frausein neu. Da erschreckte sich das Patriarchat ganz außerordentlich über die neuen Aussichten: Frauen mit mehr Freiheit und freien Knöcheln. Also tat das Patriarchat, was es am Besten kann. Es erinnerte sich, dass es doch eigentlich selbst am Besten wußte, was gut für Frauen – insbesondere für ihre Gesundheit – war. Und warnte eindrücklich davor, dass Wind, Anstrengung und notwendige Konzentration beim Radfahren die Gesichtsknochen hervorquellen lassen und damit das wertvolle weibliche Gesicht zerstören. Natürlich in der Annahme, dass Frauen sich hauptsächlich Sorgen um die Erhaltung ihres Aussehens machen. Wer über die Historizität lächelt, kann kurz überlegen, was heute für ein frisch-jugendlich-stressfreies Gesicht getan werden sollte.
Die neu erfundene Krankheit hatte nicht lange Zeit, sich auszubreiten. Fahrradfahren wurde schnell in der britischen upper class populär und damit vollständig akzeptiert. Aber ein bisschen durfte sie um die Jahrhundertwende grassieren und zeigt, was noch vor Kurzem Wissenschaft war, kann im nächsten Moment zur Absurdität werden. Es gibt ihn nicht, den schnellen Weg zur Gleichheit. Aber nicht selten kommt etwas in Bewegung.
Die ersten Fahrräder, mit einem Rad, das viel größer war als das andere, fuhren eine Weile ganz gut. Aber irgendwann kam man darauf, dass es unpraktisch war – und lächerlich aussah. Man beschloss, wenn man tatsächlich schnell und sicher in die richtige Richtung wollte, mussten alle Räder die gleiche Größe haben.
Was will ich also zum 8. März schreiben? Seid keine Idioten. Denkt an das Fahrradgesicht. Und die gleich-großen Räder.
Foto: Pinterest