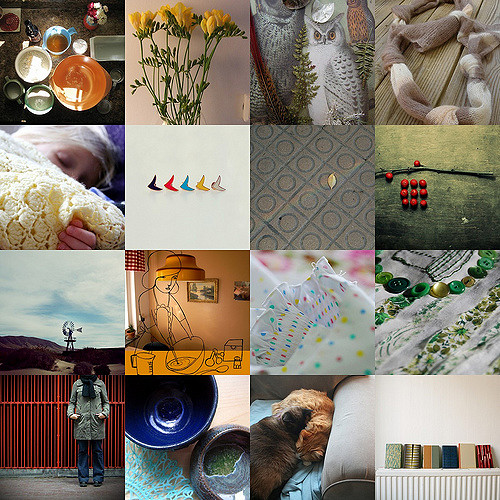Mein neues Buch ist da. Es heißt „Freundinnen“ und ist anders als das erste. Auch dort gab es schon persönliche Anekdoten, jetzt habe ich noch mehr erzählt.
Das Buch nahm in einer Zeit Gestalt an, in der in meinem Leben viel passierte. Schicksalsschlag könnte man es nennen, eine Krise vielleicht. Etwas, das die Dinge in Frage stellt: Prioritäten, eingeschlagene Wege, Zukunftsvorstellungen. Ich las viele Memoiren und von persönlichen Geschichten inspirierte Bücher. Vielleicht, weil man unbewusst auf andere und in ihre Leben schaut, wenn man eine Richtung sucht. Ich überlegte, dass wir eigentlich nur über Geschichten, über Bruchstücke unserer Erinnerung etwas voneinander erfahren. Wenn ich frage: „Wie war deine Kindheit?“, dann bekomme ich eine andere Antwort als wenn ich frage „Wer hat dir die Zähne geputzt, wer hat dir vorgelesen, deine Haare geflochten?“
Am Anfang dieses Buches stand ein diffuses Gefühl. Weil ich selbst oft genervt dastand und dachte „Oh Mann, Menschen!“ Das machte mich traurig. Unsere Unterschiede und unser „Ich“ betonen wir gern und stellen sie nach vorn. Wir sieben Menschen aus, bezeichnen sie als „toxisch“, finden für die Verhaltensweisen anderer schnelle Diagnosen. Dabei sind es oft nicht die Menschen an sich, die uns verärgern, sondern die Umstände.
Es ist unser schnelles, vollgepacktes Leben, das wenig Zeit bietet, um durchzuatmen, uns einzulassen, wirklich für andere da zu sein. Zu oft flicken wir nur uns selbst schnell wieder zusammen, damit es am nächsten Tag weitergehen kann. Es scheint die einfachere Lösung, uns zu entfernen, Beziehungen zu beenden oder einschlafen zu lassen. Dabei zeigen so viele Studien, dass es nicht nur gesunde Ernährung und Bewegung sind, die uns gesund halten, sondern vor allem Beziehungen. Von Zufriedenheit und dem ominösen Glück ganz zu schweigen.
Ich habe in meiner Krise erlebt, wie schön es ist, wenn Menschen da sind. Ich wollte ein Buch schreiben, das über meine Geschichten an eigene Freundschaften und Beziehungen erinnert. Eines, das Mut macht, ihnen mehr Zeit zu schenken. Nicht, weil sie Konten sind, auf die wir einzahlen und die dann eine bestimmte Rendite bringen. Nicht weil sie Versicherungen gegen die Einsamkeit wären, sondern, weil sie uns in all ihren Phasen zu Menschen machen und unser Leben lebenswert. Ich glaube, wir existieren erst über den Blick der anderen wirklich.
Lohnt es sich überhaupt Freundschaften zu schließen, wenn manche so böse auseinander gehen, habe ich mich manchmal während des Schreibens gefragt. Ja, würde ich immer sagen. Weil immer etwas bleibt. Nie ist alles weg, nie alles zerstört. Immer hat man etwas voneinander und über sich selbst mitgenommen. Es ist wie mit der Liebe. Auch nach dem größten Herzschmerz lieben wir irgendwann weiter. Das ist die Sache mit der Liebe und dem Untertitel des Buches (Freundinnen – Die andere große Liebe, nur besser). Denn in der Liebe nehmen wir Auf und Abs selbstverständlicher in Kauf.
Freundschaften stellen wir schneller hinten an. Gerade, wenn sie vermeintlich der Liebe im Weg stehen. Dabei sind sie genauso wertvoll, die andere große Liebe eben. Dafür müssen wir in sie investieren. Manchmal vergessen wir zur Feier unserer Individualität andere einzuladen. Freundschaften sind wesentlich. Sie zu erhalten beduetet da zu sein, auch wenn einem nicht einhundertprozentig danach ist.
Es ist viel Herz in dieses Buch geflossen, viel Zeit sowieso. Ich hoffe, dass es seine Leserinnen findet und dass es Mut und Lust auf andere Menschen macht. Auf die kleinen und großen Glückmomente mit ihnen genauso wie auf die Talfahrten. Ein wenig mehr „wir“ kann uns allen nur gut tun.
Foto: The New York Times photo archive, via their online store, here (via Wikicommons)